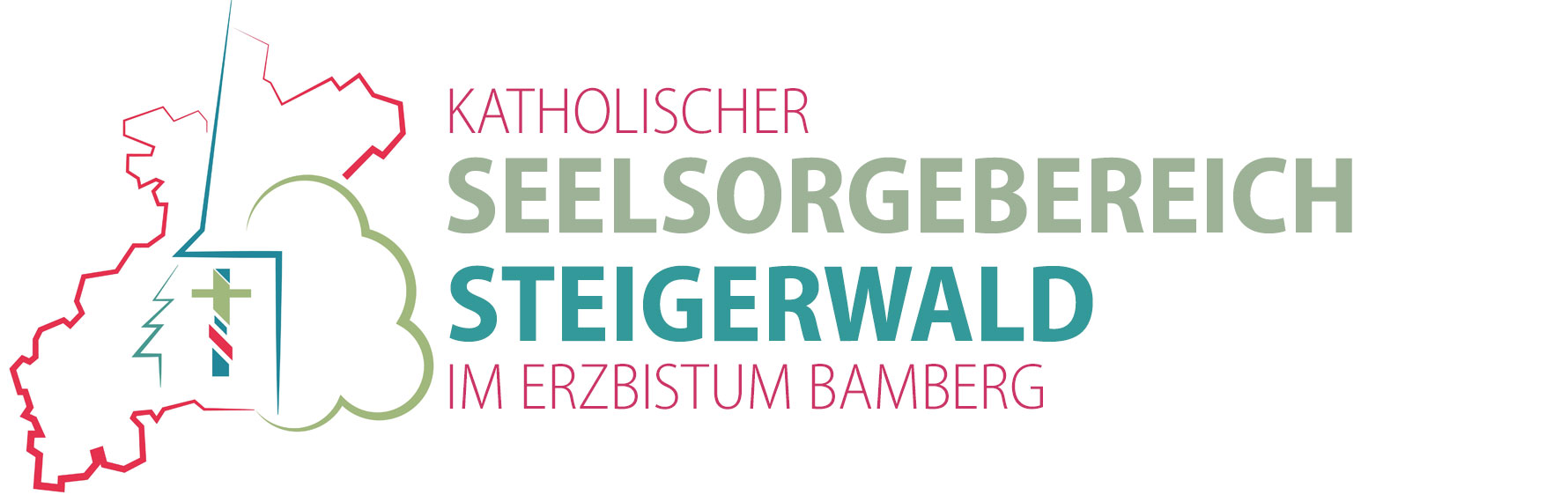Neben seiner längst versunkenen Wasserburg und dem späteren ebenfalls verfallenen Renaissanceschloss war es seine Pfarrei, die Frensdorf als eine der ältesten und wohl auch bedeutendsten im Ebrachgrund über die Jahrhunderte geprägt haben. Nichts anderes gilt für seine von alters her dem Hl. Johannes dem Täufer geweihte Pfarrkirche, dessen Patronat auf deren hohes Alter zurückweist. Noch heute künden der Chorraum des massiven Turmes sowie zwei 1980 aufgefundene, im "roten" Vorhof der Kirche aufgestellte, romanische Kirchenportale des 12. Jahrhunderts von jener wohl zwischen 1200-1220 von der Dombauhütte parallel zum Bamberger Dom mit errichteten Stein- bzw. Pfarrkirche. Die Gründung einer eigenen Pfarrei soll aus eben dieser Zeit bezeugt sein, während ein Pfarrer erstmals im Jahr 1341 urkundlich erwähnt wird. Seither oblag die bischöfliche Pfarrei hochstiftlichen Chorherren aus Bamberg (Oberpfarrer), deren gewöhnliche Pfarrdienste in der Regel sog. "Leutpriester" (Konvektoren) versahen. Seit 1655 versahen diesen Dienst dann reguläre Weltpriester.
Indes könnte die Geschichte der St. Johannes-Kirche noch weiter zurück, in das Frankreich Karls des Großen, reichen und eine selbständige Pfarrei dementsprechend bereits um die Zeit der Bistumsgründung im Jahr 1007 bestanden haben.
Jedenfalls muss ein erster Kirchenbau, wohl aus Holz, als Eigenkirche der Grafen von Frensdorf schon im 12,. Jahrhundert existiert haben, als deren bekanntester Vertreter der Hochstiftvogt Rapoto von Abenberg - "Vranestorf" hier seine wuchtige Wasserburg mit eigener Kirche, jedenfalls eine Burgkaplanei mit einem von ihm ausgebildeten eigenen Priester, bauen ließ. Dieser mächtige Rapoto, ein Verwandter großer Heiliger, der Hl. Stilla, der Hl. Hedwig und der Hl. Elisabeth und im Jahr 1139 "Urkundsvater" von Frensdorf, war eine der prägenden Persönlichkeiten seiner Zeit, ja der Orts- und Pfarrgeschichte von Frensdorf überhaupt. Im Meranischen Erbfolgestreit, wohl 1253 erstmals und als Vergeltungsmaßnahme für Raubrittertum um das Jahr 1308 nochmals stark zerstört, erfolgte ein Wiederaufbau dieser ersten Kirche erst um das Jahr 1350 als mittelalterliche Chorturmkirche. deren 1,5 Meter dicken Längsseiten blieben bis 1980 im wesentlichen erhalten, ebenso der damals der damals eingeweihte Altarstein im Hochaltartisch bis heute.
Der untere Teil des Kirchenturmes entstand mit seinen gotischen Gewölbeansätzen noch aus dieser Zeit. Der Turm trug im Mittelalter ein Fachwerkobergeschoss und neben dessen Spitze vier Eck- bzw. Wachtürmchen, angelehnt an die vier Domtürme zu Bamberg. Erst 1691 erhielt der Turm seine heutige Gestalt und Größe mit dem markanten Spitzhelm.
Weil fünf Nachbarorte eingepfarrt wurden, schuf C. Leidner 1713 ein verlängertes Langhaus mit der heutigen Deckenhöhe und doppelstöckigen Emporen. Der Chor erhielt eine barocke Formung, denn nun hielt auch in der Kirche das Zeitalter des Barock Einzug. Während die beiden barocken Seitenaltäre jener Anfangszeit des 18. Jahrhunderts entstammen, ist der Hochaltaraufbau von 1773 ein spätes Meisterwerk des Bamberger Künstlers B. Kamm in glänzendem Spätrokoko und frühem Klassizismus. Die ausdrucksstarke Pieta aus dem frühen 16. Jahrhundert inmitten des rechten Seitenaltares gilt als meisterhafte Nachbildung eines früheren Werkes von 1380.
Im Jahr 1807 erwarb Pfarrer Dumbert durch Eigenmittel aus der protestantisch gewordenen Stefanskirche zu Bamberg deren 1695 von Georg Götz geschaffene Kanzel. Das prächtige Werk des Hochbarock mit seiner reichen Akanthusdekoration ziert seither als ein Blickfang den Kirchenraum.
Neben diversen weiteren wertvollen barocken Figuren aus dem 18. und 19. Jahrhundert treten besonders hervor der edle Chorbogenkruzifixus aus den Jahren um 1500 sowie der noch der frühen mittelalterlichen Kirche entstammende Taufstein mit gotischem Maßwerk.
Ihre heutige Gestalt mit den beiden neuen Seitenschiffen und den diese krönenden je drei markanten Seitengiebeln sowie dem neu entstandenen kreuzgangähnlichen Vorhof mit dem Brunnen des guten Hirten erhielt die St.Johannes-Kirche bei ihrer großzügigen Verbreiterung in den Jahren 1980/81, woraufhin die historischen alten Emporen, bis auf die dem Altar gegenüber gelegene, wegfielen. Die vier kraftvollen Tragepfeiler im Innenraum bezeichnen heute die Breite der vormaligen, seit dem Bau von 1353 bis zur letzten Kirchenerweiterung bestehenden alten Kirche.
Die neue 24-Register-Orgel von 1987 - die vierte ihrer Art in der Kirche - aus der renommierten Orgelbauwerkstätte Eisenbarth nach alter Handwerkskunst gefertigt, beeindruckt in Fülle und Brillanz ihres Klanges. Das neben der Kirche gelegene Pfarrhaus geht auf das Jahr 1630 zurück, wovon noch das fürstbischöfliche Wappen am Giebel zeugt.
Ein in den 80er Jahren entstandenes neues Pfarrzentrum integriert die historische Pfarrscheune als Pfarrsaal und steht als Jugendheim der Jugend, als Pfarrheim der Öffentlichkeit zur Begegnung offen.
Der alte Pfarrsprengel des 17. und 18. Jahrhunderts hat sich Ende des 20. Jahrhunderts wiederbelebt, ja noch erweitert, seit die Pfarrei sämtliche Gemeindeteile von Frensdorf umfasst. Erst seit wenigen Jahren wird darüber hinaus auch die Nachbargemeinde Pettstadt von Pfarrer Wolfgang Schmidt geistlich mit betreut.
Das Wappen der Gemeinde Frensdorf, bestehend aus den zwei gravitätischen Löwen des Grafen Rapoto von Abenberg-Frensdorf und der Gestalt des Hl. Johannes Baptista versinnbildlicht die große Bedeutung dieses Heiligen seit 1000 Jahren, nicht nur als Patron der hiesigen Kirche, sondern mehr noch als Schutzpatron des gesamten Dorfes durch die Jahrhunderte.