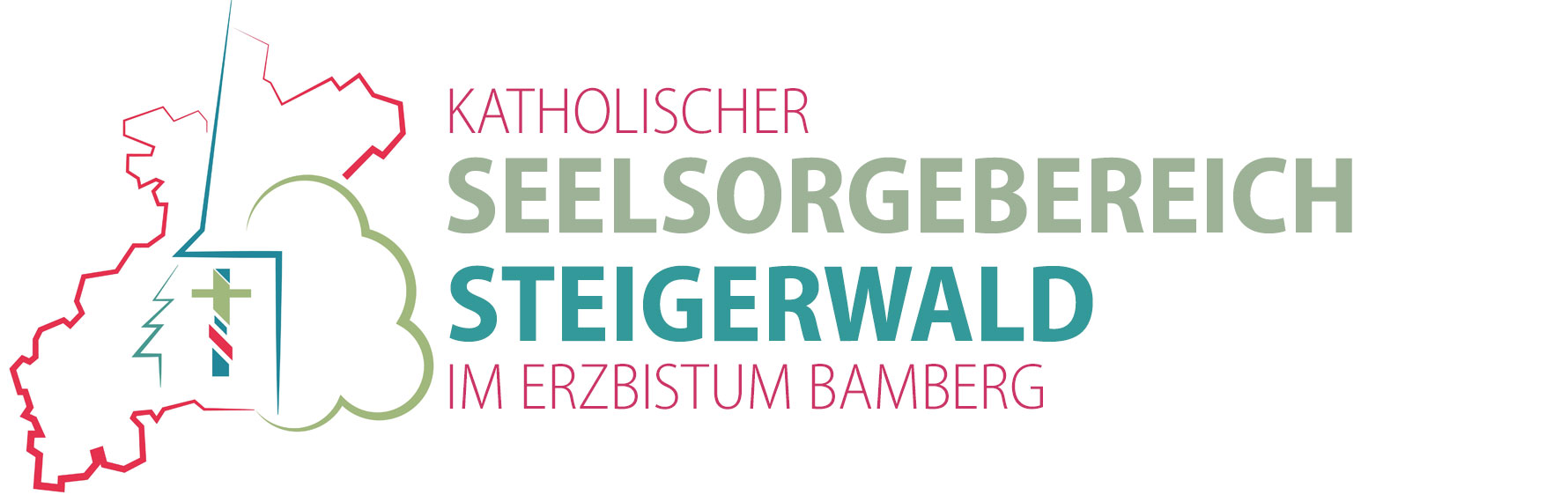Geburt und Herkunft
Bei seiner Geburt im Jahre 251 in Komä bei Heraklea, Mittel-Ägypten, herrschte eine der größten Christenverfolgungen aller Zeiten, die Kaiser Decius (249-251) ausgelöst hatte. Heute heißt der Ort Keman, im Altertum als Heraklea bekannt. Antonius war der Sohn wohlhabender Eltern, die er leider schon früh verlor. Sie dürften schon Christen gewesen sein. Auf jeden Fall haben sie ihn christlich erzogen. Sie hinterließen ihm und seiner Schwester ein ansehnliches Vermögen. Als Bauern hatten sie wohl Ackerbau betrieben, der nur im Überschwemmungsbereich des Nils möglich ist.
Bekehrung
Als Antonius einmal dem Gottesdienst beiwohnte und dem Vortrag des Evangeliums lauschte, war er tief beeindruckt von der Aufforderung Jesu: „Wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Dann folge mir nach!“( Matthäus 19,21). Die Worte ließen ihn nicht mehr los. Er verkaufte seinen Besitz. Nachdem er ausreichend für seine jüngere Schwester gesorgt hatte, die er in die Obhut frommer Jungfrauen gab, verteilte er den Rest den Armen
Zug in die Einsamkeit
Im Nachbarsdorfe gab es damals einen Greis, der seit den Tagen seiner Jugend als Einsiedler lebte. Er betete viel, blieb aber nicht untätig. Was er für seinen Lebensunterhalt nicht benötigte, teilte er unter den Bedürftigen aus. Ihm wollte nun Antonius nacheifern.
Zunächst blieb der junge Einsiedler in der Nähe des Dorfes. Danach zog es ihn in ein Felsengrab, das sich in der Libyschen Wüste befand, die auch „die Thebaische“ genannt wird. Später nahm er seine Wohnstätte in einer verfallenen Burg oder „Kastell“ auf dem Berg Pispir in der Nähe der Stadt Aphroditopolis. Hier vertiefte er sich noch mehr in die Welt des Gebetes. Es waren besonders die Psalmen, die er rezitierte. Ihre Reihenfolge merkte er sich mit Hilfe von Schnüren, an denen er Steinchen verschob. Zum Ausgleich flocht er Körbe, die er seinen Besuchern schenkte. Er soll auch einen kleinen Garten bearbeitet haben. Er ließ sich Hacke, Beil und Getreide bringen, und soll später Kohl angebaut haben. 20 Jahre soll er hier zugebracht haben.
Versuchungen
Je mehr den Heiligen die Geheimnisse Gottes erfassten, umso größer wurden seine Anfechtungen, seine Zweifel und auch seine Glaubensschwierigkeiten. Worin mögen sie wohl bestanden haben? Sie sind auf dem Colmarer Altar beschrieben: Sinnlosigkeit, ängstliche Sorge, Sinnlichkeit. Der Legende nach sollen es auch schöne Frauen gewesen sein, die seine Phantasie bedrängten. So zeigt das Sambacher Altarblatt die Versuchung durch die sogenannte „Frau Welt“. Ein andermal war es der Teufel selbst mit seinen Dämonen, die ihn quälten und seine Zelle in Brand steckten. Der aus Colmar stammende Maler, Zeichner und Kupferstecher Martin Schongauer (*1450) zeigt in einem seiner eindrucksvollsten Kupferstiche den Heiligen im Mönchsgewand, umschwirrt von einem Gewirr Furcht erregender und abenteuerlich aussehender Dämonen, die ihn auf jede erdenkliche Weise quälten (entstanden um 1480). Diese Darstellung hat sicher auch der große Maler Matthias Neidhart, später als Grünewald bekannt geworden, gekannt. Für das Antoniterkloster von Isenheim im Elsaß malte er um 1512 den berühmten „Isenheimer Altar“, der heute im Museum Unter den Linden in Colmar zu bestaunen ist. Er birgt mehrere Darstellungen des Wüstenvaters mit Szenen aus seinem Leben, so z. B. seinen Besuch beim Einsiedler Paulus. Der sterbende Einsiedler soll ihm seinen Mantel aus Palmenstroh hinterlassen haben. Wie beim Schongauer Stich erscheint auch hier das grauenvolle Szenarium der Versuchung der Bedrängnis durch die Dämonen. Damit befasste sich in der Neuzeit in Bild und Wort auch der Dichter Wilhelm Busch, wobei er leider den einen Antonius mit dem anderen verwechselte, was ja gar nicht so selten vorkommt.
Der Mönchsvater
Immer häufiger wurde Antonius von Menschen aufgesucht, die das gleiche Leben führen wollten wie er. So entstanden recht bald zahlreiche Einsiedlerniederlassungen in seiner Nähe. Nach der Bestattung des Einsiedlers Paulus, nimmt er als Vermächtnis dessen aus Palmenstroh geflochtenes Gewand an sich. Als die Mönchskolonie zu zahlreich geworden war, zog er sich immer weiter in die Wüste zurück, jenseits des Nil auf den „Berg Kolzim“, wo er ein Kloster gründete. Deshalb gilt dem Mönchsvater auch die Ehrenbezeichnung „Stern der Wüste.“ Die Wüste bevölkerte sich mit Mönchen, die ihr Hab und Gut verließen und „Himmelsbürger“ wurden. Ihre Ansiedlungen in den Bergen nahmen sich aus wie Zelte voll göttlicher Chöre. Sie sangen Psalmen, betrachteten das Wort Gottes, fasteten, beteten und verharrten fröhlich in Erwartung der künftigen Güter. Es ist nicht wahr, dass Antonius und seine Einsiedler nur be-teten und auf Kosten anderer lebten. Wie der Apostel Paulus verdienten auch sie sich mir ihrer eigenen Hände Arbeit ihr tägliches Brot. Was übrig blieb verschenkten sie an die Armen. So erbat sich Antonius eine Feldhacke, ein Beil und etwas Saatgetreide. Jahr für Jahr zog er sich sein eigenes Brotgetreide heran, voll Freude darüber, dass er darum niemanden mehr belästigen musste. Um seine Gäste bewirten zu können, baute er auch etwas Gemüse an.
Wunderzeichen
Auf das Gebet des hl. Antonius hin soll die Tochter eines militärischen Befehlshabers namens Martianus geheilt worden sein. Der sandte einen Boten zum Heiligen mit der Bitte zu der Kranken zu kommen. Darauf antwortete Antonius ganz aufgeregt: „Mensch, was schickst du nach mir? Ein Mensch bin ich wie du. Wenn du aber an Christus glaubst, dem ich diene, so gehe hin, bete zu Gott nach deinem Glauben und dein Gebet wird in Erfüllung gehen.“ Sogleich begann jener zu glauben und rief Christus an. Seine Tochter aber war bald geheilt.
Christenverfolgung unter Diokletian bzw. Maximinus Daza (303 – 311)
Im Jahre 311 soll Antonius die christlichen Bekenner in ihren Gefängnissen in Alexandrien besucht und ihnen Glaubensmut zugesprochen haben. Dann habe er sich wieder in die Wüste zurückgezogen, den Boden bebaut und andere Einsiedler besucht und betreut.
Kampf gegen Arius (335-337)
Noch ein weiteres Mal soll Antonius die Wüste verlassen haben. Die Auseinandersetzungen zwischen Athanasius, dem Bischof von Alexandrien und dem Irrlehrer Arius forderten ihn heraus. Das bewog den der Welt abgeschiedenen Einsiedler die Wüste zu verlassen und nach Alexandrien zu kommen. Gegen Arius, der die Gottheit Christi leugnete, verteidigte Antonius die wahre Lehre, dass der Sohn dem Vater wesensgleich ist. Auf Bitten des hl. Athanasius schrieb er sogar einen Brief an Kaiser Konstantin. Darin versucht Antonius ihn und seine Söhne als Mitstreiter gegen den Arianismus zu gewinnen.
Tod und Begräbnis
Als sich Antonius am sogenannten “Inneren Berg“ zum Sterben niederlegte, sah er alle die zu ihm kamen freundlich an, bis ihm das Auge brach. Vorher hatte er seine Kleider an die Armen verteilt. Er soll 105 Jahre alt geworden sein. Als Todestag gilt seit alters her der 17. Januar, weshalb sein Patronatsfest auch an diesem Tag begangen wird. Der Überlieferung nach soll er in der Nähe der Stadt Tabensi gestorben sein. Weil er seinen Schülern befohlen hatte, ihn heimlich zu begraben, gilt seine Grabstätte zunächst als unbekannt und unauffindbar. In dem Zusammenhang erhebt sich aber die berechtigte Frage, wie ist möglich war, dass seine Reliquien in den Westen kamen. Nach einer weiteren Überlieferung soll das Grab im Jahre 561 aufgefunden worden sein. Die Erhebung und Überführung der Gebeine erfolgte angeblich zuerst nach Alexandrien. Wegen der Sarazenen, die Ägypten erobert hatten, sollen sie 635 von hier nach Konstantinopel gebracht worden sein. Im 11. Jh. wechselten sie nach Frankreich, wo sie zunächst in St. Didier de la Motte vorübergehend, dann aber 1491 in der Kirche St. Julien im südfranzösischen Arles eine endgültige Bleibe fanden.
Die Antoniter
Im Jahre 1059 kam es zur Gründung des Antoniterordens in St. Didier de la Motte in Frankreich. Papst Urban II. (1088- 1099) genehmigte und bestätigte ihn als regulierten Chorherrenorden des heiligen Antonius. Nach anderen Quellen soll der Orden der „Hospitaliter vom heiligen Antonius“ erst 1095 entstanden sein. Ein französischer Edelmann namens Gaston soll hierher die Reliquien des hl. Antonius gebracht haben, nachdem sein Sohn vom „Antoniusfeuer“ durch Berührung mit den Reliquien geheilt worden sei. Anlass für seine Erkrankung gab eine im Jahr 857 erstmals überlieferte Epidemie, der sog. „Kriebelkrankheit“, hervorgerufen durch Genuss von mit Mutterkorn verunreinigtem Brot. 1119 erfolgte die Weihe der ersten Antoniuskirche durch Papst Kalixt II. (1119-1124). Die Gründungsurkunde einer weiteren Abtei „Saint- Antoine“ südlich von Genf, die bald zum Sitz des Ordens werden sollte, ausgestellt von Papst Bonifaz VIII. am 10. Juni 1297, weist auf das wesentliche Anliegen der Antoniter hin: die Kriebelkrankheit zu behandeln. Ihre Hospitäler waren – wenn man dies mit einem modernen Vergleich sagen darf – die Fachkliniken der damaligen Zeit, in der nur diese Krankheit behandelt wurde. Im Mittelalter soll es ca. 365 – 369 Spitäler gegeben haben, die die Antoniter betreuten. Im Jahre 1381 gründete Adalbert von Bayern den Antoniter-Ritterorden. 1491 mussten die Reliquien des Ordenspatrons nochmals auf Wanderschaft gehen und zwar in die Kirche St. Julien nach Arles. Die Verehrung des Heiligen erreichte im 14. und 15. Jh. ihre Blütezeit. In der Reformation ging der Orden zunächst in Deutschen Landen ein, später im Barockzeitalter kam es zu seinem Niedergang. Warum? Er hatte schlichtweg keine Existenzberechtigung mehr. Die Kriebelkrankheit, der Anlass zu seiner Gründung, war verschwunden. In den Hospitälern der Antoniter gab es nur noch wenige oder gar keine Kranken mehr. Spärliche Reste des Ordens gingen schließlich 1777 im Malteserorden auf.
Entsprechend den Ernährungsgewohnheiten im Hoch- und Spätmittelalter nahm Getreide einen hohen Anteil ein. So kam es häufig vor, dass vor allem in Zeiten von Missernten und Hungersnöten minderwertiges Getreide mit vermahlen wurde. Auf diese Weise gelangten erhebliche Mengen an Mutterkorn ins Brot, wodurch die schon erwähnte Krankheit entstand. Man bezeichnete sie auch als Antoniusfeuer („ignis sancti Antonii“). Bei der Neuaufnahme eines an Mutterkornbrand Erkrankten wurde nicht nur gebetet, sondern ihm frisches reines Brot und ein mit Heilkräutern versehener Wein dargereicht. Daran möchte die heute in Sambach und in anderen Antoniuskirchen gebräuchliche Brot- und Weinsegnung erinnern. Der Aufnahme ging eine gründliche Untersuchung voraus. Denn nur den vom Antoniusfeuer befallenen Kranken sollte und durfte im Hospital der Antoniter geholfen werden. Auch Frauen spielten bei Untersuchung und Pflege eine wichtige Rolle.
Das „Antoniusfeuer“ machte sich bemerkbar vor allem durch auftretende Rötung der Glieder, die sich in schweren Fällen zum brandartigen Absterben steigerte. Zeigte die Behandlung mit Antoniuswein keine nachhaltige Wirkung mehr, musste man zur Amputation der befallenen Gliedmaßen schreiten. (Siehe Abbildung der Wundarznei von Hans von Gersdorff aus dem Jahre 1517). Der Eingriff erfolgte ohne Narkose. Danach galt es Krücken und Gehhilfen für die Betroffenen anzufertigen.
Antonius - Kreuz
Mit seiner TAU- Form (T) soll es gerade die Krücke der Gehbehinderten und zu Krüppel Gewordenen symbolisieren, deren sich der Orden in besonderem Maße annahm. Es ist zu seinem Zeichen schlechthin geworden. Es findet sich auf zahlreichen Antoniusdarstellungen, wie auch auf dem Umhang der Ordensangehörigen und Pfleger. Es gibt sicher noch andere Deutungen. So ziert das Antoniuskreuz in der Sambacher Kirche die Sitzfigur des Kirchenpatrons, auf dem Altarblatt ist es auf seinem Mantel ganz deutlich zu sehen. Auf dem Dreifaltigkeitsschild hält er das Antoniuskreuz als Stab in der Hand. Das gleiche Motiv finden wir auch auf einem mit Goldfaden gestickten Rauchmantel, der zum Fest und zu Hochzeiten Verwendung findet. Die Form des Antoniuskreuzes erscheint weiterhin in den Nischen der Kanzel, der Emporenbrüstung und des Ambo-Lesepultes.
Wir wissen nicht genau wie das Kreuz Christi tatsächlich ausgesehen hat. Einer Überlieferung nach habe der Herr nur den Querbalken hinauf nach Golgatha geschleppt, während der Längsbalken schon dort aufgerichtet stand. Darauf wurde der Querbalken nur noch aufgesetzt.
Es könnte sich beim TAU, nach anderen Autoren, auch um ein altes ägyptisches Lebenszeichen handeln. Später trug man es auch als Amulett gegen die Pest.
Als weitere Attribute unseres Heiligen gelten: ein Buch, das Schwein, das Glöckchen. Vereinzelt erkennt man ihn auch an einer Fackel oder an Feuerflammen und einem Teufelskopf. Letzteren zeigt auch das Sambacher Altarblatt.
Das Buch
Damit ist die Bibel gemeint, in die er sich vertiefte und eifrig las. Es könnte sich im Besonderen auch um den Psalter handeln. Das ist ein Buch mit den 150 Psalmen, die er immer wieder betete. Dabei half ihm eine Schnur, an der er Steinchen anreihte und verschob.
Das Schwein
Wie kam Antonius zum Schwein, das zu seinem speziellen Wappen wurde? Es lassen sich damit sicher gewisse Bezüge zu seinen teuflischen Versuchungen herstellen. Denn das Schwein wühlt ja bekanntlich mit seinem Rüssel im Dreck und im Schmutz. Unter den Tieren, die ihn anfielen, mögen wohl auch Schweine gewesen sein. Direkt aber hat es kaum etwas mit dem Leben des hl. Antonius selbst zu tun, sondern mit den Antonitern. Das Schwein auf den Antoniusbildern und Figuren weist vor allem auf die häufige Stiftung von Schweinen an den Krankenpflegerorden hin. Aufnahme, Untersuchung und Behandlung der Kranken mussten auch damals finanziert werden, denn die Errichtung und In-standhaltung der Hospitäler war ebenso kostspielig wie die Verpflegung der Kranken und die Entlohnung der Ärzte. Da von den Patienten in der Regel nichts zu erwarten war, fand der Orden andere Wege. Aufgenommen und gepflegt wurden alle, ganz gleich ob sie vermögend oder bettelarm waren.
Als Entschädigung für seine vielfachen Krankendienste erhielt der Orden das Privileg der freien Schweinezucht. Das heißt, die Antoniter durften ihre Schweine überall im Land frei laufen lassen. Allerdings mussten sie mit einem kleinen Glöckchen versehen sein, damit sie keinen allzu großen Schaden anrichteten. Ebenso trugen sie das TAU als Erkennungszeichen eingebrannt auf ihrer Haut. Sie wurden im Laufe des Jahres mit Abfällen und freiwilligen Futtergaben gemästet. Meist schlachtete oder verkaufte die Dorfgemeinschaft dieses sog. „heilige Schwein“ am Antonitag, dem 17. Januar und übergab dem Orden entweder das Schwein oder den Erlös. Darüber hinaus war das Ferkel die Gabe der Armen. Noch heute heißt der heilige Antonius deshalb in Altbayern der „Sautoni“, in Westfalen und im Rheinland, wo es zahlreiche Antoniuskirchen gibt – „Swiene-Tüns“.
Das Glöckchen
Wie schon erwähnt trugen die Schweine, die für die Antoniter bestimmt waren ein Glöckchen. Ein solches Glöckchen schwangen aber auch die Antoniusboten, die der Orden aussandte. Auf genau festgelegten Routen zogen sie durch einzelne Balleien, um Spenden zu sammeln. „Ballei“ hieß das Sammelgebiet, dem ein Präzeptor vorstand. Mehrere Präzeptoren unterstanden dem Generalpräzeptor. In Saint Antonine in Frankreich war der Sitz des Generalpräzeptors des gesamten Ordens. Sobald die Antoniusboten in ein Dorf oder in eine Stadt kamen, schwangen sie ihr Glöckchen und riefen die Bewohner herbei. Zuerst wurden in der Regel die Kinder aufmerksam. Sie riefen dann auch die Erwachsenen herbei. Was sich nun abspielte glich einer Volksmission. Es wurden Gottesdienste mit Predigt gehalten und Spenden gesammelt.
Das Glöckchen hatte aber noch eine weitere Bedeutung. Wenn ein Kranker auf die Isolierstation kam, gab der begleitende Pfleger mit dem Glöckchen ein Zeichen, damit die Leute sich wegen der großen Ansteckungsgefahr von dem Kranken fernhalten sollten.
Mit dem Antoniusglöckchen malte Joseph Dorn den Kirchenpatron auf das Dreifaltigkeitsschild, das er 1841 seiner Heimatgemeinde Sambach schenkte.
Verehrung als Schutzpatron der Tiere
Die Fürsprache Antonius des Großen wird angerufen bei Rose und Pest. Der Rotlauf im 1. Stadium bei Schweinen wird heute noch „Antoniusfeuer“ genannt. In manchen Darstellungen erscheint er mit einem Flammenbüschel in der Hand. Das sog. „Antoniuswasser“ das heute noch gesegnet wird, wurde den von Antoniusfeuer befallenen Tieren gereicht. In manchen Gegenden wurde der Einsiedler Antonius den 14 Nothelfern zugezählt. Im Rheinland zählt man ihn mit Hubertus, Quirinius und Kornelius zu den 4 heiligen Marschällen. Nebst Florian wird Antonius auch gegen Feuersgefahr angerufen. Dabei mag die Erzählung aus seiner Legende mitgespielt haben, dass die ihn quälenden Dämonen, seine Zelle in Brand setzten. Mit Gottes Hilfe gelang es ihm jedoch diesen zu löschen. Auf den Umstand, dass Antonius Schutzpatron der Tiere ist, geht der Brauch zurück, an seinem Festtag die Tiere zu segnen. So auch seit einigen Jahren in Sambach, wie vor weiteren Antoniuskirchen.
Patrozinium in Sambach
Im 12. und 13. Jh. dürften die Antoniter auch in Sambach Besitzungen und Güter gehabt haben. Wahr-scheinlich erscheint sogar, dass es hier auch ein Hospital gegeben hat. Denn das Recht Antoniuskirchen und Altäre zu errichten lag ausschließlich beim Orden. Nur so lässt es sich erklären, dass schon vor der Zeit der Pfarrgründung 1295 das erste Sambacher Kirchlein Antonius dem Einsiedler geweiht war. Wie aus Ostertags Skizzenbuch hervorgeht, ist die spätgotische Sitzfigur des hl. Antonius im Jahre 1480 entstanden.
Nach dem Wieder- und Neubau 1709-1730 ließen die Jesuiten ein Altargemälde anfertigen zum Thema: „Die Versuchungen des hl. Antonius“. Der Maler könnte Christoph Wilhelm oder Georg Albrecht Meuser gewesen sein. Der Einsiedler liest und betet in der Bibel. Im Anbetracht der Versuchungen durch den Teufel und die „Frau Welt“ gedenkt er seines Todes. Daran erinnert der gut sichtbare Totenschädel. Zu seinen Füßen rechts das Schwein als sein Attribut und vor ihm der Krug mit Wasser.
Auf dem Dreifaltigkeitsschild von Joseph Dorn sieht man Antonius in einer Mönchskutte, Stab und Glöckchen in der Hand.
Text: H. H.Pfarrer Egmont Topits, Sambach
QUELLEN
- Leben und Versuchungen des heiligen Antonius nach der im 4. Jh. vom Bischof Athanasius verfassten Biographie, herausgegeben von Nikolaus Hovorka mit Erläuterungen zum Urtext von Ernst Stein – Ausstattung von Rose Reinhold – 1925 Wien-Berlin im Reinhold- Verlag.
- Hans Hanakam – Antonios der Große – Stern der Wüste 1989 ISBN 3-457-08625-5 im Herder-Taschenbuch-Verlag(Reihe: Texte zum Nachdenken)
- Annette Faber „Unsere Heiligen“ Leben, Legenden und Kunstwerke im Erzbistum Bamberg, Verlag Fränkischer Tag 2000, ISBN 3-928648-55-1
- Lexikon für Theologie und Kirche
- Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten - Legende und Darstellung in der bildenden Kunst von Hiltgart L. Keller (Philipp Reclam Jun. Stuttgart 1975)
- Das große Heiligen-Lexikon von Clemens Jöckle im Karl- Müller- Verlag 1995
- Friedrich Hiller „Die Kirchenpatrozinien des Erzbistums Bamberg „St. Otto- Verlag Bamberg 1932
- Chronik der Pfarrei Sambach nach Aufzeichnungen von G. R. Barnickel
- Ein Schutzpatron in vielen Nöten(Altöttinger Lieb-Frauen-Bote Nr. 3/1998)
- Antoniter Forum, Heft 1/1993(Herausgegeben von der Gesellschaft zur Pflege des Erbes der Antoniter e. V. – Verlag der Gesellschaft, 35305 Grünberg, Rosengasse 2/Hessen) EOS Druckerei, 86941 St. Ottilien.